Neustadt 466
Wertschätzung statt Verdrängung: Sanieren ohne zu verstecken

Neustadt 466, ein kleines schmuckloses Haus in der Landshuter Neustadt, verborgen zwischen Prunk- und Neubauten fällt es einem durch seine mittelalterliche Maßstäblichkeit, – wenn überhaupt – erst auf den zweiten Blick auf. Obwohl das Anwesen durch seine Unscheinbarkeit Jahrzehnte lang im Sinne seiner Denkmalbedeutung unterschätzt wurde, bewahrte dieser Umstand das Haus vor gröberen und größeren Eingriffen. Und erhielt so noch einen Großteil seiner Ursubstanz, die uns Einblicke bis in die Gründungszeit der Stadt Landshut ermöglicht. Ein Schicksal das vergleichbare Bauten in Landshut aus gleichen Gründen nicht teilen dürfen und buchstäblich von der Bildfläche verschwunden sind.
Geschichte des Hauses
Projekttyp: Denkmalpflege, KfW Sanierung
Bauherr: Fichtel GbR
Ort: Landshut
Status: im Gange
Leistungsphasen: 1-9
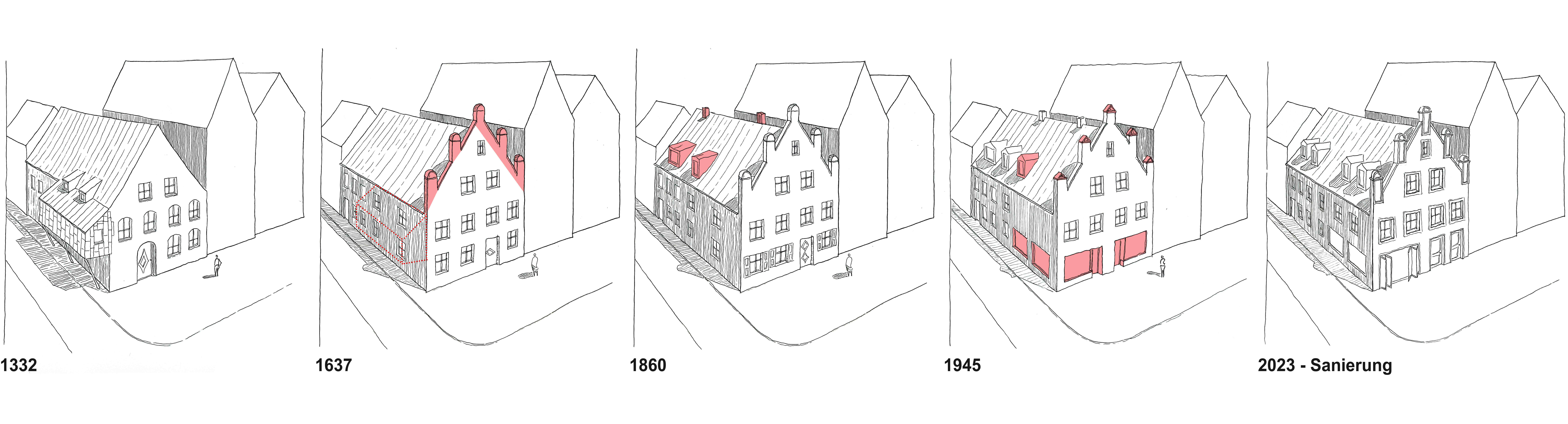
1332: Die Neustadt Landshuts wurde um 1280 angelegt. Der Stadtbrand von 1342 zerstörte viele alte Bauten, doch dieses Haus, 1332 errichtet, blieb erhalten. Das Stadtmodell von 1570 zeigt das Gebäude mit zwei Vollgeschossen, Satteldach und schlichten Giebeln. Die Ostfassade hatte bereits die heutigen Öffnungen; im Erdgeschoss gab es einen Hauseingang zur Neustadt. Der breite Erker über der Steckengasse wirft Fragen zur Konstruktion auf – möglicherweise war er ein hölzerner Anbau. Der Erker führte zu einer asymmetrischen Ostfassade und einem nach Süden verschobenen Firstpunkt, was an der Position des mittleren Pfeilers und der einseitigen Aufmauerung des nördlichen Ortgangs erkennbar ist.
1634: Von 1637 bis 1640 führte die Pfarrei St. Lazarus umfangreiche Umbauten am Haus durch, möglicherweise zur besseren Veräußerung. Der beschädigte Erker wurde 1639 abgebrochen (gestrichelt), die Südfassade ergänzt (in rot) und ein neues Dach mit gezapften Holzverbindungen errichtet. Der Firstpunkt des Giebels wurde versetzt, und der Ortgang auf der Nordseite aufgemauert. Die Deckenbalken im Obergeschoss wurden erneuert; ein Teil könnte als Spunddecke über der Stube ausgeführt sein.
1860: 1860 wurde das Haus innen umgestaltet: Das Treppenhaus kam an die heutige Stelle, und im Obergeschoss entstanden zwei Wohneinheiten. Die Deckenbalken der östlichen Haushälfte wurden erneuert. Ein älterer Kamin blieb in der östlichen Wohnung, während ein neuer Kamin für die westliche Wohnung entweder entlang der nördlichen Wand verlief oder später ersetzt wurde. Die neue Treppe reicht bis ins erste Dachgeschoss, was auf einen Wohnungsausbau hinweist. Aus dieser Zeit stammen die ältesten Teile der Ausstattung, darunter eine einfache Treppe und Wohnungstüren. 1894 wurde im Kataster ein „Neubau“ vermerkt, der den Einbau von zwei Ladeneinheiten und Toiletten im Hof betraf. Der Eigentümer Jakob Schachtner verkaufte das Haus 1895 an den Getreidehändler Michael Schachtner.
1945: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die älteren Kamine durch zwei russische Kaminzüge ersetzt. Mitte des Jahrhunderts verlegte man die Sanitärräume ins Innere und errichtete Wände aus verputzten Heraklitplatten. Der Vorraum wurde vom Wohnraum der westlichen Wohnung abgetrennt. Spätere Umbauten im Erdgeschoss führten zu den heutigen Schaufenstern, Toiletten und Hausflur. Im Obergeschoss wurden die Räume mit Gipskartonwänden aufgeteilt. Ab ca. 1960 wurden alle Fenster und viele Türen erneuert, und die Zinnen der Ostfassade erhielten Betonsteinplattenabschlüsse.
kurioses Detail:
Die Baugefügeuntersuchung von Herrn Lindauer zeigt, dass das Gebäude zu den ältesten der Stadt zählt und sogar älter ist als die Martinskirche! Dennoch wurde es erst 2019 auf Anregung des Vereins Freunde der Altstadt e.V. nachträglich in die Denkmalliste aufgenommen.
Ein fast 700 Jahre altes Gebäude
Das Gebäude in der Neustadt 466 ist ein fast 700 Jahre altes Bauwerk, das den Stadtbrand von Landshut überlebt hat, die Landshuter Hochzeit erlebt hat und bereits stand, bevor die Martinskirche errichtet wurde. Es ist offensichtlich, dass ein so altes Gebäude niemals die Funktionalität und Perfektion eines Neubaus erreichen kann. Doch es stammt aus einer Zeit, in der Städte für Menschen und nicht für Autos, Büros oder Konsum entworfen wurden. Durch seine Lage, seine Proportionen und seine mittelalterliche Maßstäblichkeit strahlt es eine Gemütlichkeit aus, die Neubauten nicht bieten können.
Die Herausforderung der Sanierung
Die Herausforderung bestand darin, all diese Qualitäten zu bewahren, und zwar obwohl man das Haus restaurierte. Warum „obwohl“?. Weil der Begriff „restaurieren“ oft so verstanden wird, dass am Ende eine vollständige Wiederherstellung des früheren Erscheinungsbildes steht und mit den Fortschritten in der Bauforschung wäre eine perfekte Rekonstruktion durchaus möglich! Um jedoch die eben genannten Vorzüge – vor allem die spürbare Geschichte des Hauses – zu erhalten, wäre es nicht sinnvoll gewesen, all diese technischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Daher stellte sich die Frage: was ist die richtige Sanierungsmethode für dieses Haus?
Zeitgemäßes Sanierungskonzept
Für die Sanierung wurde eine Methode gewählt, die eher auf Reparatur abzielte. Das übergeordnete Ziel war also nicht das spurlose Heilen, sondern durch praktische und bauwerkschonende Instandsetzungen den Schaden als Ereignis und die Schadensgeschichte bewusst sichtbar zu lassen. Diese reparaturorientierte Sanierung bedeutet keineswegs eine lieblose Instandsetzung der Funktionalität des Gebäudes, sondern vielmehr die Verbindung von Alt und Neu auf Basis von praktischen Erfahrungen und eben nicht auf Basis von Ideen und Ideologien.
Die enge Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen war entscheidend für den Erfolg dieses Konzepts. Nur durch dieses Zusammenspiel war es möglich, dass einerseits mit der Substanz schonend umgegangen wurde und andererseits dort wo Erneuerungen notwendig waren, immer eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen werden konnte, egal ob es um formale Anpassungen ging, oder um Neugestaltungen.
So entstand ein ambitioniertes und aktuelles Sanierungskonzept. Aktuell deswegen, weil es ein Gegenbeispiel zur Bestandsfeindlichen Wegwerfmentalität ist und ambitioniert, weil man sich gegen die Tendenz eines nur Vordergründigen Nachahmens früherer Zustände stellte.
Mit diesem Konzept wird gezeigt, dass die Würde eines alten Hauses erhalten bleiben kann obwohl, oder gerade weil kleinere Altersspuren im Original belassen werden und nur dort wo Eingriffe statisch nötig ist, man diese mit einer Art Prothese repariert.
Dadurch, dass diese Methode, den geringsten Eingriff in die historische Substanz zur Folge hatte, war sie denkmalpflegerisch die verantwortungsbewussteste und nachdem so die Altersgeschichte immer noch präsent ist, war es auch künstlerisch die überzeugendste Methode.
Das Haus erstrahlt nun in neuem Glanz und zeigt stolz die Spuren seines Alters sowie seiner einzigartigen Geschichte.

Mangelnde Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit erforderten notwendige Sicherungsmaßnahmen, bevor mit den Arbeiten begonnen werden konnte. Links und in der Mitte: Verfaulte Deckenbalken und Sparren ohne Auflagefläche. Rechts: Queraussteifungen zur Stabilisierung der Dachstruktur vor der Sanierung.

Halbzeit der Dachsanierung: Die abschnittsweise Sanierung ermöglicht ansprechenden Vorher-Nachher-Vergleich der Dachsanierung. Hier: Blick vom bereits sanierten Bereich in den noch zu sanierenden Bereich.

Halbzeit der Dachsanierung: Die abschnittsweise Sanierung ermöglicht ansprechenden Vorher-Nachher-Vergleich der Dachsanierung.

Im Bereich der Traufknoten waren sämtliche Zerrbalken und Sparrenköpfe stark beschädigt. Zur minimalinvasiven Sanierung der Fußpunkte entschied man sich gegen ein beidseitiges Anlaschen und wählte stattdessen die Ausführung mit Rückhängung und Knagge. Der Randbalken stellt eine überdimensionierte Variante der Randbohle dar, die in Kombination mit der OSB-Beplankung eine stabile Scheibe auf der letzten Geschossdecke bildet. Durch das größere Randholz können Vertikalkräfte über die Knagge und Horizontalkräfte durch die Verschraubung mit den Zerrbalkenlaschen in die darunterliegenden Tragsysteme eingeleitet werden. Auf dem Foto rechts sieht man den Zustand des Traufknotens vor und nach der Sanierung

Erhalt der historischen Sitznischen. Bildlicher Vergleich der Zustände vor der Sanierung, während der Sanierung und im fertiggestellten Zustand.

Foto vor der Balkensanierung im Erdgeschoss. Die Starke Beschädigung der Balkenlage und die unterdimensionierten der Querschnitte der Balken machten einen zeitgemäßen Ausbau unmöglich. Behoben wurden dieser Missstände durch beidseitiges Anlaschen der Balken.

Bildlicher Vergleich der Fassade vor und nach der Sanierung. Rückbau der dreieckigen Waschbetonplatten auf den Zinnen und Ausführung der bauzeitlichen Zinnenausbildung.
Wirtschaftlichkeit trotz Denkmalschutz?
Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit denkmalgerechter Sanierungen ist von großer Bedeutung. Viele Menschen empfinden nämlich Denkmäler als reine Liebhaberei und es gibt das Vorurteil, dass man nicht denkmalgerecht und wirtschaftlich zugleich sanieren kann. Doch der Umgang mit dem Bestand, egal ob Denkmal oder nicht, ist fast immer wirtschaftlicher als ein Neubau. Betrachtet man alle Fördermöglichkeiten wie Denkmalabschreibungen, günstigere Kredite, Tilgungs- und Investitionszuschüsse, wird deutlich, dass der Arbeitsaufwands vielleicht höher ist, dass aber der Umgang mit dem Bestands in jedem Fall finanziell vorteilhafter ist.
Es ist jedoch wichtig, das Objekt in der Gesamtschau zu betrachten und nicht isoliert; beispielsweise sollten spätere Mieteinnahmen nicht einfach den Baukosten gegenübergestellt werden.
Es wäre einfach gewesen, vor der Sanierung von Neustadt 466 zu behaupten, das Gebäude müsse abgerissen werden, denn die Gebrauchstauglichkeit und die Standsicherheit war zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr gegeben. Man hätte das nur mit Modeworten wie „Unzumutbar“ oder „Gefahr auf Leib und Leben“ schmücken müssen, dann wäre die Abbruchgenehmigung leicht möglich gewesen.
Aber wozu? Durch Fördermöglichkeiten wie Denkmalabschreibungen, günstigere KfW-Kredite, Tilgungs- und Investitionszuschüsse war es zwar ein sehr hoher Arbeitsaufwand, aber in jedem Fall finanziell vorteilhafter mit dem Bestand umzugehen. Der Denkmalschutz ist also keineswegs als Bürde oder Abwertung für ein Gebäude zu betrachten, vielmehr ermöglicht er die Möglichkeit, ein Stück Geschichte weiterzubeleben und aktiv zur Bewahrung der Identität unserer Heimatstadt beizutragen.
Hoffentlich kann dieses Beispiel dazu beitragen, die Einstellung gegenüber denkmalgeschützten Häusern nachhaltig zu verändern. Es liegt an allen – seien es interessierte Bürger der Stadt, Nutzer, Planer oder Investoren –, sich diesem notwendigen Umdenken anzuschließen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann sichergestellt werden, dass in Zukunft weniger Denkmäler verschwinden und stattdessen als wertvolle Zeugen unserer Geschichte erhalten bleiben. Gemeinsam sollte dafür eingetreten werden, dass die Schönheit und Bedeutung historischer Bauten auch für kommende Generationen bewahrt bleibt.

Wohnzimmer im 1.OG mit sanierten Sitznischen. Die für dieses Projekt modifiziert Wandlampen setzt die liebevoll sanierte, historische Substanz in Szene, ohne die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu ziehen.

Dachgeschosswohnung. Von der alten Substanz und dem Dachtragwerk von 1639 blieb so viel wie möglich erhalten. Lediglich die morschen oder verfaulten Sparren- und Zerrbalken-Abschnitte wurden in bester Zimmermannskunst profilgleich mit stehendem Blatt saniert.

Tanz auf der Treppe – Platzsparen mit Stil: Die Treppe wurde als „Sambatreppe“ gestaltet, um im Dachgeschoss keinen wertvollen Platz zu verschwenden. So bleibt mehr Raum für kreative Ideen und gemütliche Stunden!

Ziegelgeschichten – wenn Geschichte umgesiedelt wird und zeigt was hätte sein können! Die Sichtmauerwerk (rechts) und im Giebeldreieck (oben links) wurden mit Ziegeln eines anderen Einzeldenkmals errichtet, das bedauerlicherweise nicht liebevoll saniert, sondern einfach „weggeschoben“ wurde.
Erfahren Sie mehr über das Projekt: Im Rahmen des Denkmaltages wurde eine interessante Dokumentation erstellt. Klicken Sie hier.
